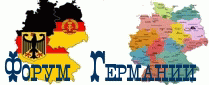
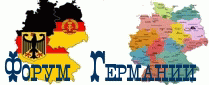 |
Auferstanden aus Ruinen
gegen jede Abweichung vom Historischen,
gegen jede Anspielung auf zeitgenossische Architektur stemmen. Nur einer ist dabei, der Stadt einen sichtbaren Kontrapunkt zu setzen: Daniel Libes - kind. Der amerikanische Architekt baut derzeit das Militarhistorische Museum der Bundeswehr um, ein uber hundert Jahre altes klassizistisches Ensemble. Mitten hin - ein pflanzt Libeskind einen 30 Meter hohen, neben dem Eingang aufragenden spitzen Keil, der das Gebaude nach au?en hin teilt, sich im Inneren aber mit ihm verbindet. Der storende Dorn weist uber den Fluss hinweg direkt auf die Dresdner Altstadt. Vielleicht helfen solche Beispiele, Gegner und Liebhaber moderner Bauten zu versohnen, das Neue sinnvoll im Alten sichtbar zu machen. Denn bedenkenswert sind jene Einwande schon, die gegen eine uferlose und unreflektierte Rekonstruktion historischer Gebaude vorgebracht werden. Vor einer „Retrowelt“, in der nicht mehr sei, was es scheine, warnt Architekturkritiker Pehnt. In vielen Stadten prasentiere sich heute das, was Historisches darstellen solle, neu wie am ersten Tag. Ein Paradox: „Nur das, was makellos erscheint, ist alt, sonst ware es ja renoviert worden“, so Pehnt. Er pladiert dafur, behutsamer und nachdenklicher vorzugehen, „das Vorhandene aufzunehmen, ohne das Neue zu verleugnen“. Meisterlich gelungen ist dies dem britischen Architekten David Chipperfield mit einem der uber Jahre umstrittensten Bauvorhaben der Republik: dem Neuen Museum in Berlin. Das vor einem halben Jahr eroffnete Haus, in dem originale Bauteile mit modernem Material verknupft und Folgen von Verwitterung und Krieg konserviert werden, beweist eine eindrucksvolle Synthese von Alt und Neu, von Ruinenkultur und zeitgenossischem Bauen. Dabei steht das Neue Museum wie die ganze wiedervereinigte Stadt fur die Bruche in der wechselhaften deutschen Geschichte. Aufstieg, Niedergang und Wiederaufbau, Humanismus, Gro?enwahn und Barbarei haben an vielen Orten ihre sichtbaren Spuren hinterlassen. Die Verwerfungen und Wunden bewusst nicht von der Sehnsucht nach dem Alten und (vermeintlich) Heilen uberdecken zu lassen, sondern sich – siehe Holocaust- Mahnmal – auch der Schande zu bekennen, die eigene Vergangenheit gewisserma?en zu kommentieren: Das demonstriert Berlin ziemlich konsequent. Der Reiz der Hauptstadt fur jahrlich fast acht Millionen Besucher aus aller Welt geht gerade davon aus, dass sich hier wie nirgendwo sonst in Deutschland Zeitgeschichte hautnah erleben lasst. Im Guten wie im Schlechten. ROMAIN LEICK, MATHIAS SCHREIBER, HANS-ULRICH STOLDT |
Technik- und Umweltsoziologe Ortwin
Renn, und dies in einer Zeit, in der auch die familiaren Bindungen oft schwacher wurden: „Da stellen sich viele immer drangender die Frage: Wo komme ich eigentlich her? Wo gehore ich hin?“ So werde Geschichte interessant, vor allem jene vor der eigenen Haustur. Doch wie lange ist ein Original noch ein Original? Was ist mit Gebauden, die nicht einmal mehr an ihrem Ursprungs - platz rekonstruiert wurden, wie das Leibnizhaus in Hannover? Und mit jenen Gebilden wie der 2007 in Braunschweig rekonstruierten klassizistischen Schlossfassade, hinter der sich eine glitzernde Ladengalerie auftut? Da sollten puristische Kritiker auch einen Blick auf die benachbarte Kaufhausfassade der sechziger Jahre wagen, eine Riesen-Waffel, die ihr Innenleben nicht weniger kaschiert als die Schlossfassade, nur eben viel scheu?licher aussieht. „In einem demokratischen Staat hat die Burgerschaft das Recht, die Gestaltung des offentlichen Raums zu bestimmen“, meint der Munchner Architekturhistoriker Winfried Nerdinger, „ob einem das nun im Einzelfall gefallt oder nicht.“ Enorm beflugelt hat alle Liebhaber historischer Baukunst der Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche. Dieses Vorhaben war zunachst ebenfalls umstritten. Das protestantische Gotteshaus, ein Stadt-, kein Staats- und Herrschaftssymbol, konne nur eine Attrappe darstellen, sei ein Phantom oder Teil eines Disneyland, atzten Kritiker. Doch getragen von einer breitgefacherten Burgerbewegung, war die Realisierung nicht aufzuhalten. Kaum jemand mag heute mehr an der Sinnhaftigkeit zweifeln. Ein wenig anders verhalt es sich bei der Rekonstruktion barocker Gebaude am Dresdner Neumarkt, einem vor 65 Jahren komplett zerstorten Areal. „Wir durfen nicht die Rentner bedienen, die noch mal ihre Vergangenheit sehen wollen“, polemisierte der geburtige Dresdner Architekt Peter Kulka, als erste Plane diskutiert wurden. Durchsetzen konnte er sich nicht. „Die Dresdner haben erstaunlich hartnackig an der Vorstellung festgehalten, dass ihre Stadt schon ist – auch als sie es nicht war“, so Dirk Syndram, Direktor des Grunen Gewolbes. Das erklart die Vehemenz, mit der sich viele Bewohner |
siedelten
sich am Flussufer an, hinzu gesellten sich Gaststatten, Clubs und Discotheken. Fur optische und asthetische Sensationen sorgten internationale Stararchitekten wie David Chipperfield oder Frank Gehry. Dessen 1999 fertiggestellte taumelnde Buroturme („Der Neue Zollhof“) sind langst ein Wahrzeichen der nordrhein- westfalischen Landeshauptstadt Heute wird die einstige Brache am Rhein „Medienhafen“ genannt und ist mit ihrer ungewohnlichen Architektur den Dusseldorfern ans Herz gewachsen. Ob Vergleichbares in Stuttgart ebenfalls gelingen kann, vermag derzeit al - lerdings niemand zu sagen. Nach gut 20 Jahren Planung ist dort Anfang Februar der Startschuss fur das zurzeit gro?te verkehrspolitische Projekt der Bundesrepublik gefallen: „Stuttgart 21“. Der Kopfbahnhof im Zentrum der Stadt soll nebst Gleisanlagen verschwinden und elf Meter unter der Erde als moderne Durchgangsstation wiedererstehen. Futuristisch anmutende, nach oben gewolbte riesige Bullaugen werden nach dem Willen des Dusseldorfer Architekten Christoph Ingenhoven die Bahnsteige mit Tageslicht versorgen. Wo derzeit noch Gleise und Weichen liegen und Stuttgart uber eine weite Strecke regelrecht zerschneiden, sehen die Planer auf rund hundert Hektar eine neue Stadtmitte entstehen, mit Buroturmen, Wohnungen, Parks und Freizeitanlagen. „Wann bekommt eine europaische Gro?stadt so eine Chance?“, fragt Wolfgang Drexler, Vizeprasident des badenwurttembergischen Landtags und Kommunikationsbeauftragter fur das Projekt. „Diese verkehrspolitische Vision bringt eine Beschleunigung fur die ganze Region.“ Der Raumgewinn ist fur die von Hugeln eingekesselte Stadt in der Tat ein Segen, sie platzt aus allen Nahten. Doch die meisten Bewohner hadern. Und wahrend zum Auftakt der Bauarbeiten die Planer von einem „Jahrhundertwerk“ schwarmten, skandierten Demonstranten lautstark: „Lugenpack! Lugenpack!“ Etlichen missfallt die radikale Umgestaltung der gewohnten und gewachsenen Umgebung. Dass auch ein unter Denkmalschutz stehendes Wahrzeichen ihrer Stadt, das beinahe hundert Jahre alte Bahnhofsgebaude, teilweise Opfer der Abrissbirne wird; dass fast 300 alte Baume im Schlosspark weichen mussen (obwohl spater 5000 neue gepflanzt werden sollen) – das alles schurt den Widerstand. Die Leute hatten eben Angst, ein Stuck Heimat zu verlieren, sagt der Stuttgarter |
Ein ehrgeiziges Stadtebaukonzept ist
das, weit entfernt von jenen Errungenschaften der Nachkriegszeit, wo Trabantensiedlungen weitgehend isoliert auf das flache Land geworfen wurden. Kilometerlange Uferpromenaden sollen die stadtischen Arbeits- und Wohnstatten einrahmen, ein eigener Yachthafen und eine Universitat sind ebenfalls geplant. Und dazu, naturlich, die Elbphilharmonie. Nichts weniger als ein neues Wahrzeichen wollen sich die Hanseaten damit geben – gleich der Oper von Sydney. Finanziell noch ein Fass ohne Boden, werde der aufregende Bau aus gekrummtem Glas und rotem Backstein inmitten der Elbe Millionen Besucher aus aller Welt anziehen und den Hamburgern selbst reichlich Anlass geben, sich mit ihrer Heimatstadt frisch zu identifizieren. So zumindest die Erwartung. Dass moderne, spektakulare Bauten dies durchaus schaffen konnen, hat Dusseldorf bereits erlebt. Denn nicht allein die Tatsache, dass etwas alt ist, hilft Menschen, ihre Sehnsucht nach Bindung und Identitat zu stillen. Neues kann ebenfalls vorbildlich sein. Das zeigt die weitgehende Umwidmung des mehr als 100 Jahre alten Dusseldorfer Hafens. Hier, am Rheinknie, dammerten gro?e Teile des einst au?erst vitalen Areals lange Zeit nahezu ausgestorben vor sich hin. Krane, Silos und Lagerhallen rosteten ungenutzt und zerfielen. Die Wende kam Anfang der neunziger Jahre, als die Stadt den Weg fur eine neue Nutzung frei gemacht hatte. Zahlreiche Unternehmen aus der Medienbranche siedelten |
Auf nichts haben Nachkriegserneuerer
tatsachlich so wenig Rucksicht genommen wie auf den jeweiligen geschichtlichen Ort, an den sie ihre naturnahen Siedlungs- Cluster und ihre schematischen Wohnmaschinen platzierten. Auch deshalb werben und werkeln uberall Altstadtvereine, die sich fur eine Wiederauferstehung unvergessener Bauten und Ensembles starkmachen. Bereits 1989 wurde in Hildesheim das im Krieg zerstorte fachwerkprachtige „Knochenhauer-Amtshaus“ von 1529 von den Toten auferweckt, es ersetzte das „Hotel Rose“, einen lieblosen Betonbau der sechziger Jahre. Im nordrhein-westfalischen Wesel muht sich seit langem schon eine Burgerinitiative, die ungewohnliche Fassade des mittlerweile 490 Jahre alten Rathauses im flamisch-gotischen Stil zu rekonstruieren. Und in Hamburg gehen die Menschen fur den Erhalt der wenigen noch bestehenden Hauser im „Gangeviertel“ auf die Stra?e. Nur 1500 Meter Luftlinie davon entfernt lasst sich betrachten, wie ein moderner Stadtteil entsteht, der nichts mehr mit jenem einst so eng und verwinkelt gebauten historischen Armenquartier gemein haben wird. Der Gegensatz wird krass ins Auge springen – und kann doch reizvoll harmonieren. Denn pragende, heimatstiftende Statten konnen sich sehr wohl auch aus Neuem entfalten. So wachst in Hamburg, einer noch wachsenden Metropole, die sich als Weltstadt versteht, auf 157 Hektar in unmittelbarer Nahe zum Stadtzentrum die Hafencity heran. Rund 40000 Menschen sollen hier spater in Buros, Geschaften und Restaurants Arbeit finden. Damit sich das Viertel auch mit Leben fullt, ist ein Drittel der gesamten Nutzflache fur Wohnraumbebauung ausgewiesen |
Abgrenzung zur bombastischen NaziAsthetik.
Der Souveran indes maulte. „Wenn ich 16 Millionen Mark hatte, wurde ich mir etwas anderes kaufen“, schrieb ein Besucher ins Gastebuch, ein anderer mochte nur auf Franzosisch deutlich werden: „Meine Meinung: Alles Merde.“ „Was der Oesterlen gemacht hat, war seinerzeit sehr progressiv“, sagt Kai Sommer von der Landtagsverwaltung und klopft an eines der Fenster. „Aber alles nur einfache Verglasung! Auch energetisch geht das ja gar nicht mehr!“ So denken die meisten Abgeordneten. Mitte Marz beschlossen sie, das seit 1983 unter Denkmalschutz stehende Gebaude abzurei?en. „Es ist naturlich einfach, aus heutiger Sicht zu sagen, das alles sei nicht gelungen“, urteilt Albert Speer, der 1934 geborene Frankfurter Stadteplaner und Sohn des gleichnamigen Hitler-Ministers. Aber: „Man bedenke die tatsachliche Situation nach 1945.“ Die Idee der modernen Architektur sei mit der utopischen Vorstellung verbunden gewesen, „durch besseres Bauen einen besseren Menschen schaffen“ zu konnen, so Speer. Damals hatten die aufgeklarten Geister nicht mehr zuruckschauen mogen, meint der Frankfurter Architekt Christoph Mackler, 59, „zwei Saulen neben - einander waren schon Faschismus“. Sein Vater, der einstige Dombaumeister Hermann Mackler, wollte im Jahr 1947 sogar dem Frankfurter Dom ein Flachdach verpassen. In ihrer Besessenheit, modern, verkehrsgerecht und „ehrlich“ zu planen, habe die Generation seines Vaters vergessen, dass eine lebensfahige Stadt auch „mit Schonheit zu tun hat und Schonheit mit der Geschichte des Ortes verknupft ist, an dem man baut“, sagt Mackler. |
Nun fallt das Monster selbst: Neun historische
Hauser werden hier stattdessen wieder entstehen. Fast sieben Jahrzehnte nach dem Krieg bewegt das Land erneut und immer noch die hochst emotional diskutierte Frage: Was ist wert, bewahrt zu werden, und was an untergegangenen Ikonen sollte neu entstehen? Abgerissen werden nur selten die wirklich grausamen, seelenlosen Betonverbrechen mit Mullschluckereingangen, die endlich zu suhnen waren; dafur trifft es nun ofter gelungene und manchem liebgewordene Beispiele des Wiederaufbaus; die Mensa der Bauhaus-Universitat in Weimar etwa oder das niedersachsische Parlament in Hannover. Seit 1962 beraten hier die Abgeordneten die Geschicke ihres Landes – was die au?eren Umstande angeht, zunehmend lustlos. Vor allem wenn Schwefelwasserstoff- Schwaden, die der Kanalisation entweichen, durch die Reihen des fenster - losen Plenarsaals („Bunker“) wabern. Bisweilen regnet es auch noch rein. Das ehrwurdige Haus ist leicht bau - fallig geworden, aus Metallverstrebungen bluht Rost, die Hausfassade ist bruchig und die Heizung defekt. Die raumhohe Verglasung des Foyers zum Innenhof des Gebaudes ist wegen her abfallender Scherben mit truber Plastikplane verklebt. Architekt Dieter Oesterlen hatte ab 1957 das im Krieg zerstorte alte Schloss der Welfenkonige zum Entzucken vieler Hannoveraner wieder aufgebaut und ihm – da war die Freude dann schon geringer – einen modernen, kantigen Trakt mit Garten-Innenhof eingefugt: Platz fur das bis dahin in der Stadthalle beratende Landesparlament. Die Fachwelt war begeistert und sprach von einem mutigen Zeichen selbstbewusster Architektur in |
Dresdner Zwinger, die romanischen Kirchen
in Koln, die Frankfurter Paulskirche. Fur deren Wiederaufbau flossen 1947 Spenden aus allen Teilen Deutschlands nach Hessen, sogar 10 000 Reichsmark von der ostdeutschen Sozialistischen Einheitspartei (SED). Im geteilten Berlin uberlagerte die Konkurrenz der politischen Systeme den Richtungsstreit. Im Westen der Stadt entstanden auf den Trummern der Grunderzeitvillen im Hansaviertel gut geluftete, durchgrunte Hochhausreihen – wie es die Moderne befahl. Die Ost-Berliner revanchierten sich mit der Stalinallee (heute Karl-Marx-Allee), deren Ideal strenge Symmetrie und formale Geschlossenheit war. Nach 1975, dem vom Europarat ausgerufenen Europaischen Denkmalschutzjahr, wandte sich der Zeitgeist im Westen allerdings endgultig der gebauten Vergangenheit in ihren diversen Formen zu. Ungezahlte Burgerinitiativen zur Rettung alter Hauser und Viertel haben hier ih ren Ausgang genommen. Spektakularer Auftakt war der Kampf zwischen Haus - besetzern und Grundstucksspekulanten im Frankfurter Westend, einem vom Krieg einigerma?en verschont gebliebenen Villenviertel westlich des mittelalterlich ge - pragten Zentrums der Stadt, mit herrschaftlichen, von wohlhabenden Burgern des 19. Jahrhunderts errichteten Hausern. Die linken Hausbesetzer, unter ihnen der spatere Grunen-Politiker und Bundesau?enminister Joschka Fischer, verteidigten die Kapitalisten von gestern gegen die Kapitalisten von heute: die komfor - tablen Wohnhullen und Garten der ehemaligen Kaufleute, Fabrikanten und Beamten gegen jene Finanz- und Immobilienhaie, die kostbare innerstadtische Quadratmeter Bauland an den meistbietenden Investor verkaufen wollten. Jeder, der 5000 Quadratmeter Grund erwarb, durfte darauf – egal wo im Westend – ein Hochhaus setzen. Nach den Hausbesetzer-Krawallen, auf die sich Rainer Werner Fassbinders umstrittenes Theaterstuck „Der Mull, die Stadt und der Tod“ 1975 bezog, war Schluss damit. Auch das Technische Rathaus in Frankfurt provozierte jahrzehntelang den Zorn vieler Anwohner. Das neben dem „Kaiserdom“ errichtete, dreifach aufgeturmte Waschbeton-Gebirge war im Jahr 1972 nach einem Bauplan von 1963 entstanden. Drei der wenigen nicht im Krieg zerbombten Altstadthauser mussten dafur weichen. |
Aus dem gro?en Nichts entstanden so
erstaunlich rasch neue Stra?en, Schulen, Krankenhauser und Siedlungen, wie die Grindelhochhauser in Hamburg. Noch wahrend der sechziger Jahre wurden jahrlich im Schnitt 570000 Wohneinheiten produziert, im Rekordjahr 1973 waren es 714 000, dazu kamen zwischen 50000 und 150 000 neue Eigenheime. Von 1974 an schaffte auch die DDR eine Jahresproduktion von 100000 Wohneinheiten. In Westdeutschland entstanden wahrend der ersten 15 Nachkriegsjahre nicht weniger als 5,3 Millionen neue Wohnungen. Der Wiederaufbau und Neubau nach 1945 war eine fette Beute fur Architekten, Stadtplaner, Unternehmer und Baukombinate. Sie haben alle tuchtig zugepackt, aber auch nie zuvor so viel Geld verdient Die scharfe raumliche Trennung der klassischen Stadtfunktionen – wohnen, arbeiten, sich erholen – war allerdings keine neue deutsche Erfindung. Sie bildete das Kernstuck der beruhmten „Charta von Athen“, die auf einem internationalen Architektenkongress 1933 konzipiert und in der vom Schweizer Architekturstar Le Corbusier uberarbeiteten Fassung 1943 erstmals publiziert worden war. Die neuen Wohnviertel, die nach dieser Musterfibel der „funktionellen Stadt“ geplant wurden, waren „locker“ aufgeteilt und „gut durchluftet“. Das Motto lautete: „Licht und Luft fur alle!“ Mehr „Klarheit“ statt des „Durcheinanders“ der historischen Stadt mit all diesen „lastigen Nachbarn“. Das gesundere Lebensgefuhl in den sauberen Vor- und Satellitenstadten wollte sich indes nicht einstellen. Die sterile Umgebung erzeugte vielmehr Einsamkeit und Langeweile. Viele, die dorthin zogen, sehnten sich bald wieder aus den Ghettos zuruck nach der gemutlichen, chaotischen Enge der alten City. Einige Dinge gelangen in den Jahren nach 1945 immerhin: eine autogerechte Infrastruktur, wie auch immer man diesen morderischen Imperativ langfristig bewerten mag; die meist vereinfachende Reparatur etlicher herausragender Baudenkmaler, darunter das Charlottenburger Schloss in Berlin-West, das Karlsruher und das Stuttgarter Schloss, die Residenzen in Munchen und Wurzburg, der |
ses Werk der Zerstorung wird Segen wirken“,
kommentierte er das grausame Schicksal der Hansestadt und ihrer Bewohner, „das Wort des Fuhrers, dass die zerstorten Stadte schoner als vorher wiedererstehen werden, gilt doppelt fur Hamburg.“ Im Ubrigen: „Dem allergro?ten Teil der baulichen Zerstorungen weinen wir keine Trane nach.“ Nach dem Krieg durfte Gutschow wegen seiner NS-Verstrickungen nicht mehr fur offentliche Auftraggeber tatig sein. Das machte aber nichts: Ein Netz von alten Spezis versorgte ihn schnell wieder mit Arbeit. Anderswo in Deutschland funktionierten die alten Beziehungen ebenfalls prima. Vor allem in Dusseldorf wo sich ehemalige NS-Architekten gegenseitig Posten und Auftrage (unter Ausgrenzung fruherer Nazi-Gegner) zuschoben, kursierte bald ein Spottvers: „Aller Anfang ist der Ziegel und dann spater der Zement, aber nichts halt so zusammen wie ’ne Clique, die sich kennt.“ Und diese Clique tat nun so, als hatte sie mit der einstigen bombastischen Nazi- Architektur und deren gro?enwahnsinniger Ideologie rein gar nichts zu tun gehabt. Speers Architekten versteckten sich nach dem Krieg hinter dem Bauhausstil, der Moderne, wie sie schon vor 1933 von Walter Gropius und Co. entwickelt worden war. Das Bauhaus galt als Ausweis des besseren Deutschlands, weil die Nazis gegen deren Vertreter vorgegangen waren. Jeder vormalige NS-Stadtgestalter, der sich bei seiner Arbeit nun auf Gropius bezog, fuhlte sich fast wie ein Widerstandskampfer – auch sie wollten ja luftiger bauen, neuer, und ohne den Ballast des historischen Zeugs. Neue Maschinen und Bautechniken verwandelten die traditionell gemachliche stadtebauliche Entwicklung vor allem in Westdeutschland in ein hastiges Umwalzungsspektakel. Das imponierte allein schon durch sein Tempo. Wirtschaftlich war dies nur moglich, weil die Westmachte die Bundesrepublik Deutschland als starken Bundnispartner gegen die So - wjetunion brauchten und darum massiv, unter anderem uber den Marshallplan, unterstutzten. |
Anfang 1943, mitten im Hollenlarm der
Vernichtungsmaschinerie, hatte Hitlers Leibarchitekt und Reichsrustungsminister Albert Speer einen „Arbeitsstab Wiederaufbauplanung zerstorter Stadte“ gegrundet. Alles, was Rang und Namen hatte, war dabei. Die Planungen zur Umgestaltung des Reichs gingen aber noch weiter zuruck. 1940 hatte „Baumeister Hitler“ seine Visionen von einer Neugestaltung der gro?en Stadte schon in einen Erlass gegossen – „zur Sicherstellung des Sieges“. In Hamburg machte sich sogleich der Architekt Konstanty Gutschow ans Werk. Ihm schwebte eine „gegliederte und aufgelockerte Stadtlandschaft“ vor, wie sie NS-Planer auch mit dem Ziel konzipierten, die deutschen Metropolen kunftig bombensicherer zu machen. Eine weitlaufige „Stadtlandschaft“, so ein damals beliebter Planungsbegriff, lasst sich weniger effektiv aus der Luft angreifen als eine verdichtete Altstadt, wo ein Volltreffer genugt. Dazu sollten in der Hanse - stadt monumentale Bauten mit Gau hoch - haus, Aufmarschplatz und Volks halle kommen, „als Zeugen hamburgischer Weltgeltung“. Die „Operation Gomorrha“, mit der britische Bomber drei Jahre spater die zweitgro?te deutsche Stadt in Trummer legten, kam Gutschow gerade recht. „Die- |
Krieg nicht unternommen und die Zerstorung
dieses Hauses nicht provoziert“, schrieb Dirks in den „Frankfurter Heften“. „Es hat seine Richtigkeit mit diesem Unter - gang. Deshalb soll man ihn anerkennen.“ Hesse hatte mit dem Hinweis auf die „Seelenwelt“ nachkommender Generationen dagegengehalten. Sie wurden, meinte er, ohne Not „eines unersetzlichen Erziehungs- und Starkungsmittels“, einer edlen „Substanz“ beraubt. Hesse und seine Mitstreiter obsiegten schlie?lich, Goethes Geburtshaus wurde bis 1951 wiederhergestellt. Wegweisend war das nicht: Zwar gab es Ausnahmen, etwa in Freiburg, Freudenstadt oder Munster (wo bald nach Kriegsende die barocken Giebelhauser am Prinzipalmarkt vereinfacht rekonstruiert wurden), aber in der Regel kamen die Erneuerer zum Zuge. Seltsame, machtige Koalitionen bildeten sich dabei. Zu jenen Architekten und Stadtplanern, die schon vor der Nazi-Zeit modern bauen wollten, stie?en Baumeister, die aus moralischen und politischen Grunden einen radikalen Bruch mit der Vergangenheit zwingend fanden. Und dazu gesellte sich noch eine gro?e Zahl an Architekten, die eng mit der Nazi-Diktatur verstrickt waren. Die zogen Aufbauplane aus ihren Schubladen, an denen sie bereits wahrend des Krieges gearbeitet hatten. Denn |
Der Literaturwissenschaftler Ernst
Beutler, der das Museum betreute, mobilisierte 1947 – zwei Jahre vor Goethes 200. Geburtstag – die geistige Elite Deutschlands und bat sie, seinen Aufruf zum Wiederaufbau zu unterstutzen. Hermann Hesse, im Jahr zuvor mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet, schrieb: „Soll man rekonstruieren? Ich muss die Frage ruckhaltlos bejahen.“ Der Dichter Hans Carossa, der Romanist Ernst Robert Curtius, der Physiker Max Planck, der Philosoph Karl Jaspers – sie und andere Prominente waren derselben Meinung. Aber der Deutsche Werkbund, eine einflussreiche Vereinigung von Kunstlern, Architekten und Unternehmern, organisierte eine eigene Umfrage unter deutschen Intellektuellen, die sich der Moderne verpflichtet glaubten – und fand durchweg Ablehnung. „Bei Dingen, die Reliquienwert haben“, konne „niemals ein Faksimile das Original ersetzen“, sagte der Kunsthistoriker Richard Hamann. Ein Standpunkt, der unter sehr konsequenten Denkmalpflegern bis heute vertreten wird. Der prominente Publizist Walter Dirks argumentierte hingegen dialektisch: „Ware das Volk der Dichter und Denker (und mit ihm Europa) nicht vom Geiste Goethes abgefallen, vom Geist des Ma?es und der Menschlichkeit, so hatte es diesen |
Sommer unter der Sonneneinstrahlung
gluhten und in denen es im Winter bitterkalt wurde. Umso wichtiger war es, moglichst schnell ausreichend Wohnraum zu schaffen. Aber wie? Sollten die Hauser und reprasentativen Bauten an selber Stelle und in gleicher Weise wiedererrichtet werden? Oder musste man nicht die Chance nutzen, jetzt, da alles kaputt war, einen frischen Neuanfang zu wagen: die sich in engen, verwinkelten Gassen verirrenden Altstadte verkehrsgerecht aufzulockern und den Menschen hygienische, von Grunanlagen eingefasste Wohnquartiere zu geben? Wahnwitzige Uberlegungen wurden laut – den ganzen Schaden einfach wie Geisterstatten liegen zu lassen und die Siedlungen an neuem Ort zu errichten. Aber unter den Trummern lagen oft noch Werte, die aufzugeben in jener Zeit sich niemand traute: halbwegs intakte Kanalisation, Wasser-, Strom- und Gasleitungen. Sie liefen entlang der Stra?enzuge, und so kam es, dass Munchen heute nicht am Starnberger See liegt und Hannover immer noch an der Leine. Die meisten Menschen wollten indes ihre historischen Hauser wiederhaben. Uberall taten sie sich zu Altstadtvereinen zusammen, um fur ihre Anliegen zu werben. Die Fachwelt stritt daruber erbittert. Denn es ging ja nicht nur um funktionale und asthetische Erwagungen, fast wichtiger noch war die Frage, was fur ein „Geist“ mit den Bauten zum Ausdruck kommen sollte. Rekonstruktion, warnten die Anhanger eines Neuanfangs, bedeute, den Krieg zu negieren. Aber ware es demgegenuber nicht geradezu geschichtslos und auch ein Akt der Verdrangung, samtliche Spuren der Vergangenheit zu loschen, die sich ja nicht nur aus zwolf unheilvollen Jahren speiste?, wandten die Bewahrer ein. Besonders exemplarisch fur alle ideologisch aufgeladene Polemik der Nachkriegszeit, die das schwierige Verhaltnis der Deutschen zu ihrer gebauten und gro?tenteils zerstorten, aber in wichtigen Teilen durchaus rekonstruierbaren Geschichte betrifft, war 1947 der Disput um den Wiederaufbau von Goethes Geburtshaus in Frankfurt am Main. Dieser Streit traf mitten ins Herz der Kulturnation Deutschland, da, wo der Begriff „Weltliteratur“ gepragt wurde, kein provinzielles Thema also: Goethes Geburtshaus, ein Mitte des 18. Jahrhunderts im Gro?en Hirschgraben errichteter, dreistockiger verputzter Fachwerkbau, war infolge von Bombenangriffen zunachst ausgebrannt und Monate spater eingesturzt. Aus dem Gebaude, das schon im 19. Jahrhundert als Goethe-Museum diente, war in weiser Voraussicht alles historisch wertvolle Inventar gerettet worden. |
Die Aufgabe, diese Gebirge an Schutt
abzutragen und noch Brauchbares aus den Resten zu klauben, fiel in den ersten Nachkriegsjahren vor allem den Trummerfrauen zu. „Mit blo?en Handen haben wir Stahltrager, Balken und Steine aus den Gerollbergen gezogen“, erinnert sich Hildegard Brettschneider, die damals als 18-Jahrige in Dresden aufraumen half. Der Job war lebensgefahrlich. Viele Frauen starben unter einsturzenden Hauswanden, durch herabfallende Balken oder explodierende Blindganger. Es ging darum zu bergen, was wie - derverwertbar schien. Mangel herrschte schlie?lich an allem: Toilettenbecken, Herden, Rohren, Leitungen. Unbeschadigte Ziegel reichten die Frauen in Personenketten weiter, um sie am Stra?enrand mit kleinen Hammern vom restlichen Putz zu saubern. Der Schutt kam auf Pferdewagen. „Vier haben dann geschoben und eine von uns hat die Deichsel gelenkt“, sagt Brettschneider. „Das war unsere Jugend.“ Um die gro?te Wohnungsnot zu lindern, entstanden allerorts provisorische Unterkunfte, doch viele harrten monatelang in den Trummern ihrer Hauser aus. Verstarkt wurde das Elend noch durch Millionen Fluchtlinge, Vertriebene und „Displaced Persons“. In etlichen Stadten ihrer Besatzungszone errichtete die britische Armee lange Reihen und Blocke mit Nissenhutten, benannt nach einem kanadischen Ingenieur, der sich die halbrunden Wellblechhutten ausgedacht hatte. Praktisch daran war, dass ein paar Leute den Bausatz in wenigen Stunden zusammenfugen konnten. Allein in Hamburg gab es 29 derartige Siedlungen. Manchmal hausten bis zu drei Familien unter erbarmlichen Bedingungen in diesen rund 50 Quadratmeter gro?en halbierten Blechdosen, die im |
Geschichte stellt sich immer ambivalent
dar, im Umgang mit ihren Reminiszenzen lauern Fallen und tun sich Chancen auf – Architektur ist nicht neutral. Hat die rasende Geschwindigkeit des Aufbaus das Land vielleicht auch uberfordert, nicht materiell, wohl aber kulturpsychologisch, wie sich erst heute an den Spatfolgen zeigt? Oder ist der Wunsch nach der Schonheit des Alten ein Zeichen der Sattigung, ein Luxus, den man sich erlaubt, wenn das Lebensnotwendige gesichert scheint? Jahrhundertelang wurde die europaische Kulturlandschaft davon gepragt, dass urbanistische und architektonische Erneuerung in der Regel als ruhiger Fluss, als kontinuierliche Entwicklung ablief. Ausnahmekatastrophen unterbrachen den Prozess, gewiss, aber keine war so total wie der Zweite Weltkrieg. Ohne dieses flachendeckende Desaster und die als Regelwerk darauf folgende, an jeden Ort der Welt verpflanzbare Banalmoderne ist nicht zu verstehen, war - um historische Bausubstanz und malerische Altstadte heute so popular sind. „Zu hohes Veranderungstempo ruft nach Ruckversicherung“, schreibt der Architekturkritiker Wolfgang Pehnt. Und das gilt, trotz aller Leistungen, fur den gesamten deutschen Wiederaufbau seit Mitte der funfziger Jahre. Es ist ja wahrlich nicht alles gelungen in jener chaotischen Aufbauzeit nach 1945, als es zunachst ganz einfach darum ging, den Schutt beiseitezuraumen und den Menschen ein Dach uber dem Kopf zu geben. Es musste ja schnell gehen, mehr improvisiert als durchdacht, die Einzigartigkeit der Not in Deutschland lie? uber viele Fehler hinwegsehen. In den Stadten hungerten die Menschen. Wer einen Quadratmeter Krume im Hinterhof besa?, zog dort Gemuse, Kartoffeln oder Tabak. Parks, Tiergarten und Stadien wandelten sich zu landwirtschaftlichen Nutzflachen. Alles, was irgendwie verwertbar war, kam in den Topf. Hei?begehrt waren Rezepte fur Eichelkaffee, Brennnesselpudding, Lowenzahngemuse oder „Nachtkerzenwurzeln in hollandischer Tunke“, deren Zubereitung die Zeitschrift „Frau von heute“ 1947 verriet. Kinder bekamen den Rat, am Abend die Hande auf den Bauch zu pressen, um so ein Sattigungsgefuhl zu simulieren, und zum Volkssport wurde das „Fringsen“, genannt nach dem Kolner Kardinal Josef Frings, der auch die unkonventionelle Beschaffung von Lebensmitteln verteidigte. Von ehemals 16 Millionen Wohnungen existierten 2,5 Millionen nicht mehr, 4 Millionen waren wegen erheblicher Schaden kaum zu nutzen. |
Und noch immer ist dieser Prozess der
permanenten Selbsterneuerung nicht abgeschlossen. Denn 65 Jahre nachdem die Deutschen aus Schutt und Schuld gekrochen sind, 20 Jahre nachdem sie ihre staatliche Einheit erreicht haben, steht auch der Wiederaufbau zur Diskussion, wird das Geleistete in Frage gestellt und in neuer Freiheit uber Gro?stadte als Heimstatten nachgedacht. Fehler sollen korrigiert werden, die dem Tempo und dem Modernisierungswahn geschuldet waren. Ein neues asthetisches Bedurfnis drangt das aus Not geborene Prinzip der reinen Zweckma?igkeit zuruck. Der demografische Wandel – die Alterung der Gesellschaft, die Zuwandererstrome, die drohende Verwaisung man- cher Landstriche im Osten – verlangt nach einem neuen Stadtebau, anderen Wohnformen, mancherorts auch einer ungewohnten „Kultur des Schrumpfens“, wo man es fruher nur mit wachsenden urbanen Zonen und Landschaften zu tun hatte. Und anderswo tun sich Gelegenheiten auf, ganze brachliegende Areale neu zu konzipieren, Stadtviertel vom Rei?brett als neue Wahrzeichen in alte Umgebung zu setzen. Die Planer denken um, der Radika - lismus des Anfangs weicht der Behut - samkeit des Umbaus oder gar der Rekonstruktion. Eine dritte Phase des Aufbaus zeichnet sich ab, und mit ihr keimen, paradoxerweise, Nostalgie und Sehnsucht nach Geschichte, Tradition, Fixpunkten, urbanen Kernen, die im Brei der Metropolen Halt geben und Identitat stiften. Nach Statten der Erinnerung mit Zitaten der Vergangenheit, auch und gerade im fur immer Verschwundenen. Der groteske Streit um den Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses ist fur diese Ruckorientierung im Neuen genauso ein Beleg wie die Begeisterung uber die wiedererrichtete Dresdner Frauenkirche. Zum kulturellen Wesen des Menschen gehort eben auch die geschichtliche Selbstvergewisserung. Sie kann in hartnackigem Illusionismus versinken und erbarmlich scheitern, wie sich derzeit am Berliner Beispiel des Schlosses zeigt. Sie kann aber auch, wie die spendenfinanzierte Frauenkirche, das strahlende Symbol eines selbstbewussten Burgerstolzes werden. |
Streitkraft aufsteigen konnte – undenkbar
damals, im Fruhling vor 65 Jahren. Bis zu 80 Prozent der historischen Bauten bedeutender Stadte waren ausgeloscht. Berlin, Koln, Dresden, Leipzig, Magdeburg, Hamburg, Kiel, Lubeck, Munster, Munchen, Frankfurt am Main, Wurzburg, Mainz, Nurnberg, Xanten, Worms, Braunschweig, Hannover, Freiburg, Dresden – alles kaputt, eine schier endlose Liste der Verwustung. Karthago im Gro?ma?stab: So etwas war einmalig in der neueren Geschichte, eine Zerstorung ohne Beispiel als Reak - tion auf die nicht minder beispiellose Barbarei der Nazis. So viel Ende war nie. Und doch: So viel Anfang war nie. Auch fur den Wiederaufbau eines ganzen Landes gibt es in der Geschichte kein vergleichbares Beispiel. Auf den Ruckfall in die furchterlichste Vergangenheit folgte die gegenwartigste Gegenwart aller Zeiten. Der gro?te Teil des deutschen Gebaude - bestands ist nach 1948 entstanden. Das hei?t: Die meisten der Bauten, die heute in Ballungsgebieten herumstehen, sind das Werk von ein bis zwei Generationen, die zu einer forcierten Aufholjagd in die Moderne ansetzten. Rund 400 Millionen Kubikmeter Gebaudeschutt waren allein auf dem Gebiet der spateren Bundesrepublik aufgehauft. Man hatte eine zwei Meter dicke, sieben Meter hohe Mauer um Westdeutschland damit ziehen konnen. Architektonisch und stadtebaulich war die Auferstehung nach dem Inferno eine Art Fortsetzung der Kriegszerstorungen mit anderen Mitteln: Weitere 30 Prozent historischer Substanz mussten weichen. Nur scheinbar kehrte, in den achtziger Jahren, in dem zu Wohlstand und Reputation gekommenen Land beschaulichprovinzielle Ruhe ein. Der nachste Fieberschub stand bevor: die Wiedervereinigung und mit ihr die immense Aufgabe, zwar nicht mehr zerstorte, aber oft vollig heruntergekommene Orte und Gegenden wieder herzurichten. Und noch immer ist dieser Prozess der permanenten Selbsterneuerung nicht abgeschlossen. Denn 65 Jahre nachdem die Deutschen aus Schutt und Schuld gekrochen sind, 20 Jahre nachdem sie ihre staatliche Einheit erreicht haben, steht auch der Wiederaufbau zur Diskussion, wird das Geleistete in Frage gestellt und in neuer Freiheit uber Gro?stadte als Heimstatten nachgedacht. Fehler sollen korrigiert werden, die dem Tempo und dem Modernisierungswahn geschuldet waren. Ein neues asthetisches Bedurfnis drangt das aus Not geborene Prinzip der reinen Zweckma?igkeit zuruck. Der demografische Wandel – die Alterung der Gesellschaft, die Zuwandererstrome, die drohende Verwaisung man- |
Viel Vergnugen auf den Trummern des
„Dritten Reichs“. Denn der Fockeberg ist nicht durch Gletscherbewegungen oder Gebirgsauffaltungen entstanden. Hier haben die Leipziger nach dem Krieg den Schutt ihrer zerbombten Stadt abgeladen. Ahnliche Erhebungen gibt es in vielen deutschen Stadten. In Monchengladbach ist es die „Rheydter Hohe“, in Frankfurt am Main der „Monte Scherbelino“ und in Stuttgart der „Grune Heiner“, vor allem bei Modellfliegern beliebt. Die Berliner nannten ihren Haufen aus den Resten zerstorter Hauser, aus Indu - strieanlagen und Kirchen liebevoll „Monte Klamotte“. Mit knapp 115 Metern ist der Teufelsberg die zweithochste Erhebung der Stadt. Von hier aus lauschten im Kalten Krieg US-Militars mit gigantischen Abhorschusseln in den Osten. Inzwischen haben Mountainbiker, Gleitschirmflieger und Snowboarder den Hugel erobert. Sogar der Deutsche Alpenverein betreibt hier einen Kletterfelsen „Berlin ist der gro?te Trummerhaufen der Welt“, sagte der US-Stadtkommandant Frank Howley nach der deutschen Kapitulation. Die Einwohner hatten schon in den letzten Kriegsmonaten ihre zerstorte Stadt sarkastisch in „Reichstrummerfeld“ umbenannt. Es war umgeben von einem Staat, der ebenso in Trummern lag, moralisch, wirtschaftlich und politisch. Die Bombentrichter und die Hauser - skelette, die uberall emporragten wie abgebrochene schwarze Zahnreihen, waren das schreckliche Symbol einer ruinierten Kulturnation. Schutt und Schuld, ein aschfahles Never-come-back-Land – das war Deutschland im Jahre null. Dass dieses Trummergebilde sich innerhalb weniger Jahrzehnte wieder in „bluhende Landschaften“ verwandeln wurde, dass es anerkannter Partner in einem geeinten Europa werden sollte, zum Sehnsuchtsland fur Millionen Einwanderer und zur Exportweltmacht mit eigener Zerstortes Hamburg um 1945 „Dieses Werk wird Segen wirken“ |
„Mit blo?en Handen haben wir
Stahltrager, Balken und Steine aus den Gerollbergen gezogen.“ Auerstanden aus Ruinen Vor 65 Jahren lagen Deutschlands Stadte in Trummern. Mit einem beispiellosen Kraftakt gelang es, das im Krieg verwustete Land wieder aufzubauen. Doch die Ergebnisse des hastigen Neubeginns sto?en zunehmend auf Kritik. Die Sehnsucht nach verlorenen Werten wachst. Eine kuriose Prozession bewegte sich am ersten Mai-Wochenende den Leipziger Fockeberg hinauf: Die Teilnehmer schoben eigenartige Fahrkonstruktionen vor sich her, in denen sie spater den 153 Meter hohen Hugel hinab - sausen wollten. Es galt, den „19. Prix de Tacot“ auszutragen, und wie jedes Jahr jubelten Tausende Zuschauer den mutigen Teams in ihren waghalsigen Seifenkisten zu. Disziplinen gab es mehrere sowie spezielle Ehrungen, etwa den „,Lang lebe Juri Gagarin‘-Sonderpreis fur Lassigkeit beim Passieren der Radarfalle“, der in diesem Jahr an das Team „Herrenabend“ ging. Gesehen wurde auch ein rollender Biergartenschirm. Jeder, der 5000 Quadratmeter Grund erwarb, durfte darauf ein Hochhaus setzen. |
2. Strophe
Gluck und Frieden sei beschieden Deutschland, unserm Vaterland. Alle Welt sehnt sich nach Frieden, Reicht den Volkern eure Hand. Wenn wir bruderlich uns einen, Schlagen wir des Volkes Feind! Lasst das Licht des Friedens scheinen, Dass nie eine Mutter mehr |: Ihren Sohn beweint. :| 3. Strophe Lasst uns pflugen, lasst uns bauen, Lernt und schafft wie nie zuvor, Und der eignen Kraft vertrauend, Steigt ein frei Geschlecht empor. Deutsche Jugend, bestes Streben Unsres Volks in dir vereint, Wirst du Deutschlands neues Leben, Und die Sonne schon wie nie |: Uber Deutschland scheint. :| |
Die Hymne des Unrechtsstaates DDR!
Auferstanden aus Ruinen die damalige DDR Hymne. Der Text der Hymne stammt von Johannes R. Becher, die Melodie komponierte Hanns Eisler. Text: 1. Strophe Auferstanden aus Ruinen Und der Zukunft zugewandt, Lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland, einig Vaterland. Alte Not gilt es zu zwingen, Und wir zwingen sie vereint, Denn es muss uns doch gelingen, Dass die Sonne schon wie nie |: Uber Deutschland scheint. :| |
Hitler lasst in den Lehrplanen nach wie vor nicht viel Platz fur Honecker
Das alles ist seit mehr als zwanzig Jahren Vergangenheit. Die Mauer verschwand bis auf wenige Reste. Niemand war wild darauf, das Monstrum, das nach Honecker noch in hundert Jahren, 2089, stehen sollte, vor Abriss und Verfall zu schutzen. Die Mauer war nicht nur ein Schandmal fur jene, die sie errichtet hatten, sondern auch eine unangenehme Erinnerung fur diejenigen im Westen, die es in ihrem Schatten politisch ganz gut ausgehalten haben. Auch ihre Nachfolgerin, die „Mauer in den Kopfen“, ist kaum noch zu erkennen, jedenfalls nicht bei den jungen Deutschen, die nach der Wiedervereinigung geboren wurden. Fur die Generation Facebook spielt es so gut wie keine Rolle, ob einer aus Leipzig oder aus Lubeck kommt. Die „innere“ Einheit ist fur sie kein Thema mehr. Leider gilt das aber auch oft fur Schie?befehl und Mauertote. Hitler lasst in den Lehrplanen nach wie vor nicht viel Platz fur Honecker. Auch die Linkspartei, die es am besten wissen musste, singt gern das Lied, dass der Nationalsozialismus an allem schuld gewesen sei, bis hin zur Mauer. Noch immer verklaren ehemalige Diener des Regimes den Stasi-Staat, der sich einmauerte. Doch endete die deutsche Unterdruckungsgeschichte nicht 1945. Das, was von der Mauer geblieben ist, kundet von vier Jahrzehnten weiterer Diktatur, aber auch von ihrem Untergang in einer friedlichen Revolution. Die erhaltenen Mauersegmente in Berlin und die Uberreste, die entlang der ehemaligen Zonengrenze nun auch noch den Kampf gegen die Natur verlieren, gehoren zu den schrecklichsten und zugleich zu den stolzesten Zeugnissen deutscher Geschichte. Auferstanden aus diesen Ruinen ist die Freiheit. Text: F.A.Z. |
Unter Ostalgie litt der Westen lange vor dem Osten
Die Ulbricht-Honecker-Linie war noch aus dem Weltall zu erkennen. Doch in der Bundesrepublik gab es nicht wenige, die dieses Symbol des Scheiterns und der Perversion einer politischen Idee geflissentlich ubersahen. Das lag auch daran, dass im Westen bis in die Volkspartei SPD hinein viele noch vom Sozialismus als Gegenentwurf zur eigenen „kapitalistischen“ Gesellschaftsordnung schwarmten, der in der DDR hochstens hier und da ein wenig aus dem Ruder gelaufen sei, in den Minenfeldern an der Grenze zum Beispiel. Die Ulbricht-Honecker-Linie war noch aus dem Weltall zu erkennen. Doch in der Bundesrepublik gab es nicht wenige, die dieses Symbol des Scheiterns und der Perversion einer politischen Idee geflissentlich ubersahen. Das lag auch daran, dass im Westen bis in die Volkspartei SPD hinein viele noch vom Sozialismus als Gegenentwurf zur eigenen „kapitalistischen“ Gesellschaftsordnung schwarmten, der in der DDR hochstens hier und da ein wenig aus dem Ruder gelaufen sei, in den Minenfeldern an der Grenze zum Beispiel. Unter Ostalgie litt der Westen lange vor dem Osten. Auch in der „BRD“ lernte man mit der Monstrositat der Mauer zu leben. Am Schluss war man schon zufrieden damit, dass die SED die Selbstschussanlagen wieder abbaute. Diese Verstummlungs- und Totungsautomaten gingen selbst deutschen Pazifisten zu weit, die im Zweifel zwar lieber rot sein wollten, aber eben auch nicht tot. So fiel die Mauer zur Uberraschung des Westens. Was hatte man vorher auch tun sollen? Den Friedhofsfrieden gefahrden? Die Bundesrepublik und ihre Verbundeten hatten sich mit der Spaltung Deutschlands und Europas arrangiert, manche mehr als das. Nicht selten war hierzulande die Meinung zu horen, Teilung und Mauer seien die gerechte Strafe fur den Krieg. Ausnahme waren dagegen Schilder, die noch gesamtdeutsch denkende, also verdachtige Gestalten an der oberfrankischen „Grenze“ zur DDR aufgestellt hatten: dass man sich hier, am angeblichen Ende der westlichen Welt, nicht am Rande Deutschlands befinde, sondern in seiner Mitte. |
Mit dem Bau der Mauer leistete die Einparteiendiktatur der SED schon zwolf Jahre nach Grundung der DDR ihren Offenbarungseid. Segment fur Segment, Wachturm fur Wachturm setzten die ostdeutschen Kommunisten sich selbst ein 1378 Kilometer langes Monument des moralischen, politischen und okonomischen Bankrotts. Sie mussten einen Todesstreifen von der Ostsee bis zum Vogtland ziehen, um ihre Burger daran zu hindern, aus einem Staat zu fliehen, der angeblich schon das Vorzimmer zum kommunistischen Paradies darstellte. Weil dem Sozialismus mit deutschem Antlitz die Menschen in Scharen davonliefen, blieb ihm keine andere Wahl, als sich selbst als das zu entlarven, was er wirklich war: ein Volksgefangnis. Die Palisade aus Beton und Stahl, die das Regime errichtete, konnte zwar nicht den Traum von der Freiheit aufhalten, aber doch jene, die ihn traumten.
|
Deutschland und die Mauer
Auferstanden aus Ruinen Die Mauer war eine Bankrotterklarung, ein Volksgefangnis. Ihre Reste gehoren zu den schrecklichsten und zugleich stolzesten Zeugnissen deutscher Geschichte. Sie kunden vom Triumph der Freiheit. Von Berthold Kohler 13. August 2011 Seit den Romern hatte auf diesem Kontinent niemand mehr eine Mauer von solcher Lange gebaut, nicht einmal Hitler. Der „Arbeiter-und-Bauern-Staat“ aber richtete sie auf, zwei Monate nur nachdem Ulbricht die Absicht dazu noch bestritten hatte. Der „antifaschistische Schutzwall“, wie er spater getauft wurde, sollte der Ost-Berliner Propaganda zufolge die friedliebende DDR vor den Horden des Revanchismus und Imperialismus aus dem Westen schutzen, so wie fruher der Limes das Romische Reich vor den Barbaren des Nordens. Jeder, der das Sperrwerk in Augenschein nehmen konnte, wusste jedoch, dass es gegen eine Bedrohung von innen gerichtet war. Zweck dieses wahrhaft eisernen Vorhangs war es nicht, die Panzer der Nato aufzuhalten, sondern Fluchtlinge aus der DDR, auch um den Preis ihres Lebens: „Grenzverletzer“, die die „Diktatur des Proletariats“ im real existierenden Sozialismus nicht mehr ertrugen. In keinem anderen Bauwerk der DDR spiegelten sich ihre Lebenslugen so offen und brutal wider wie an dem Gefangniszaun an ihrer Westgrenze. |
Die Entwicklung in Ostdeutschland
In der Sowjetischen Besatzungszone ging der Wiederaufbau langsamer voran als in den westlichen Zonen. Die Sowjetunion unterstutzte Ostdeutschland nicht beim Aufbau, sondern sie nahm sich ihre Reparationsleistungen in Form von Betrieben, die in Sowjetische Aktiengesellschaften uberfuhrt wurden. Durch die Bodenreform 1945/1946 wurden Gro?grundbesitzer mit mehr als 100 Hektar Flache sowie Kriegsverbrecher und aktive NSDAP-Mitglieder entschadigungslos enteignet und deren Grundbesitz dem jeweiligen lokalen Bodenfonds ubertragen. 1948 fand auch in Ostdeutschland eine Wahrungsreform statt, die die Situation jedoch nur wenig verbesserte. So bluhten in Ostdeutschland Schwarzmarkt und Tauschhandel noch langer als in Westdeutschland. Aus wirtschaftlichen sowie politischen Grunden entschieden sich viele Menschen zur Auswanderung beziehungsweise zur Flucht aus der DDR. Die Lage besserte sich ab 1949 langsam, jedoch kauften die Menschen in Westdeutschland in vollen Laden ein. Im Osten wurden hingegen noch Lebensmittelmarken ausgegeben. Erst Anfang der 1950er Jahre setzte dort ein langsamer Aufschwung ein. Jedoch war die Bevolkerung immer noch unzufrieden. Die politische Fuhrung erkannte das aber nicht, und so wurde 1953, viel zu fruh, die Produktionsnorm erhoht. An diesem Punkt reichte es dann gro?en Teilen der Bevolkerung, sie gingen auf die Stra?e und protestierten gegen ihre schlechte Versorgungssituation (Aufstande des 17. Juni 1953). Ein bedeutender Wirtschaftsaufschwung setzte dann erst ab dem 13. August 1961 ein, als die innerdeutsche Grenze geschlossen wurde |
Nachkriegszeit
Als Nachkriegszeit wird allgemein die Zeit nach einem Krieg bezeichnet. In dieser Zeit werden staatliche Ordnung, Wirtschaft und Infrastruktur neu aufgebaut oder wiederhergestellt und durch den Krieg entstandene Schaden behoben – oder auch nicht. Sie ist haufig von Hunger und Knappheit an Gutern aller Art gepragt. Aus heutiger Sicht wird insbesondere die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg als „Nachkriegszeit“ bezeichnet. |
Heinz Sokolowski, Erich Kuhn, Heinz Schoneberger, Dieter Brandes, Willi Block, Jorg Hartmann, Lothar Schleusener, Willi Marzahn, Eberhard Schulz, Michael Kollender, Paul Stretz, Eduard Wroblewski, Heinz Schmidt, Andreas Senk, Karl-Heinz Kube, Max Sahmland, Franciszek Piesik, Elke Weckeiser, Dieter Weckeiser, Herbert Mende, Bernd Lehmann, Siegfried Krug, Rolf Henniger, Horst Korner, Johannes Lange, Klaus-Jurgen Kluge, Leo Lis, Christel Wehage, Eckhard Wehage, Heinz Muller, Willi Born, Friedhelm Ehrlich, Gerald Thiem, Helmut Kliem, Christian Peter Friese, Rolf-Dieter Kabelitz, Wolfgang Hoffmann, Werner Kuhl, Dieter Beilig, Horst Kullack, Manfred Weylandt, Klaus Schulze, Cengaver Katranci, Holger H., Volker Frommann, Horst Einsiedel, Manfred Gertzki, Siegfried Kroboth, Burkhard Niering, Johannes Sprenger, Giuseppe Savoca, Herbert Halli, Cetin Mert, Herbert Kiebler, Lothar Hennig, Dietmar Schwietzer, Henri Weise, Ulrich Steinhauer, Marinetta Jirkowski, Dr. Johannes Muschol, Hans-Jurgen Starrost, Thomas Taubmann, Lothar Fritz Freie, Silvio Proksch, Michael Schmidt, Rainer Liebeke, Rene Gro?, Manfred Mader, Michael Bittner, Lutz Schmidt, Ingolf Diederichs, Chris Gueffroy, Winfried Freudenberg.
|
Ida Siekmann, Gunter Litfin, Roland Hoff, Rudolf Urban, Olga Segler, Bernd Lunser, Udo Dullick, Werner Probst, Lothar Lehmann, Dieter Wohlfahrt, Ingo Kruger, Georg Feldhahn, Dorit Schmiel, Heinz Jercha, Jorgen Schmidtchen, Philipp Held, Klaus Brueske, Peter Bohme, Horst Frank, Peter Goring, Lutz Haberlandt, Axel Hannemann, Erna Kelm, Wolfgang Glode, Reinhold Huhn, Siegfried Noffke, Peter Fechter, Hans-Dieter Wesa, Ernst Mundt, Gunter Seling, Anton Walzer, Horst Plischke, Ottfried Reck, Gunter Wiedenhoft, Hans Rawel, Horst Kutscher, Peter Kreitlow, Wolf-Olaf Muszynsk, Peter Madler, Siegfried Widera, Klaus Schroter, Dietmar Schulz, Dieter Berger, Paul Schultz, Walter Hayn, Adolf Philipp, Walter Heike, Norbert Wolscht, Rainer Gneiser, Hildegard Trabant, Wernhard Mispelhorn, Egon Schultz, Hans-Joachim Wolf, Joachim Mehr, Unbekannter Fluchtling, Christian Buttkus, Ulrich Krzemien, Peter Hauptmann, Hermann Dobler, Klaus Kratzel, Klaus Garten, Walter Kittel, Heinz Cyrus,
|
In dieser Liste aufgefuhrt sind, geordnet nach ihrem Todesdatum, Fluchtlinge, die zwischen 1961 und 1989 an der Berliner Mauer erschossen wurden, verungluckten oder sich das Leben nahmen; Menschen ohne Fluchtabsichten aus Ost und West, die im Grenzgebiet erschossen wurden oder verungluckten. Aufgelistet sind auch DDR-Grenzsoldaten, die durch Fahnenfluchtige, Kameraden, Fluchtlinge, einen Fluchthelfer oder einen West-Berliner Polizisten getotet wurden.
|
Gedenken an die Opfer
Tod an der Berliner Mauer 136 Menschen sind an der Berliner Mauer getotet worden. Fluchtlinge, Menschen ohne Fluchtabsichten, aus Ost und West, DDR-Grenzsoldaten. Ein Epitaph. |
| Òåêóùåå âðåìÿ: 14:35. ×àñîâîé ïîÿñ GMT. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Ïåðåâîä: zCarot